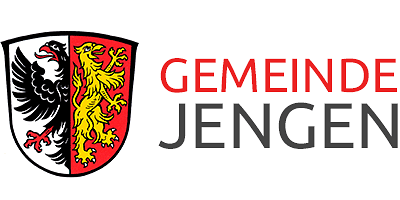Kita Weinhausen

Beiträge 2024/2025
Die Kinder können, je nach persönlichem Bedarf, angemeldet werden.
Die Stundenzahl errechnet sich aus den Gesamtwochenstunden, die das Kind im Haus sein wird.
Elternbeitrag für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres-gleichermaßen für Kiga-und Krippengruppe
(12 mal jährlich monatlich von September bis einschließlich August zu entrichten)
| 4 - 5 Stunden: | 138,10 EUR (Mindestbuchungszeit) |
| 5 - 6 Stunden: | 147,80 EUR |
| 6 - 7 Stunden: | 157,50 EUR |
| 7 - 8 Stunden: | 167,20 EUR |
| 8 - 9 Stunden: | 176,90 EUR |
Zusätzliche Kosten
Spielgeldbeitrag: 5,00 EUR (monatlich)
Die Nutzung des Gemeindebusses (ab 2. Geburtstag) ist kostenfrei und bedarf nur einer schriftlichen Anmeldung über die Kita.
Für Geschwister, die gleichzeitig in der Einrichtung betreut werden, reduziert sich der Beitrag für das 2. Kind einer Familie um 15,00 EUR.
Der Elternbeitragszuschuss des freistaats Bayern in Höhe von 100,00 EUR wird automatisch abgezogen.
Für Gastkinder
Betriebskostendefizitpauschale: 40,00 EUR (monatlich)
Elternbeitrag für Kinder von 0 bis 3 Jahren - gleichermaßen für Kindergarten- und Krippengruppen
(12 mal jährlich monatlich von September bis einschließlich August zu entrichten)
| 4 - 5 Stunden: | 235,50 EUR (Mindestbuchungszeit) |
| 5 - 6 Stunden: | 252,00 EUR |
| 6 - 7 Stunden: | 268,50 EUR |
| 7 - 8 Stunden: | 285,00 EUR |
| 8 - 9 Stunden: | 301,50 EUR |
Zusätzliche Kosten
Spielgeldbeitrag: 10,00 EUR (monatlich)
Die Nutzung des Gemeindebusses (ab 2. Geburtstag) ist kostenfrei und bedarf nur einer schriftlichen Anmeldung über die Kita.
Für Geschwister, die gleichzeitig in der Einrichtung betreut werden, reduziert sich der Beitrag für das 2. Kind einer Familie um 15,00 EUR.
Für Gastkinder
Betriebskostendefizitpauschale: 150,00 EUR (monatlich)
Beiträge 2023/2024
Die Kinder können, je nach persönlichem Bedarf, angemeldet werden.
Die Stundenzahl errechnet sich aus den Gesamtwochenstunden, die das Kind im Haus sein wird.
Elternbeitrag für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres-gleichermaßen für Kiga-und Krippengruppe
(12 mal jährlich monatlich von September bis einschließlich August zu entrichten)
| 4 - 5 Stunden: | 126,00 EUR (Mindestbuchungszeit) |
| 5 - 6 Stunden: | 135,00 EUR |
| 6 - 7 Stunden: | 143,50 EUR |
| 7 - 8 Stunden: | 152,50 EUR |
8 - 9 Stunden: | 161,50 EUR |
Zusätzliche Kosten
Spielgeldbeitrag: 5,00 EUR (monatlich)
Busaufsicht: 12,00 EUR (für Fahrkinder monatlich)
Für Geschwister, die gleichzeitig in der Einrichtung betreut werden, reduziert sich der Beitrag für das 2. Kind einer Familie um 15,00 EUR.
Der Elternbeitragszuschuss in Höhe von 100,00 EUR wird automatisch abgezogen.
Für Gastkinder
Betriebskostendefizitpauschale: 40,00 EUR (monatlich)
Elternbeitrag für Kinder von 0 bis 3 Jahren - gleichermaßen für Kiga- und Krippengruppen
(12 mal jährlich monatlich von September bis einschließlich August zu entrichten)
| 4 - 5 Stunden: | 215,00 EUR (Mindestbuchungszeit) |
| 5 - 6 Stunden: | 230,00 EUR |
| 6 - 7 Stunden: | 245,00 EUR |
| 7 - 8 Stunden: | 260,50 EUR |
| 8 - 9 Stunden: | 275,50 EUR |
Zusätzliche Kosten
Spielgeldbeitrag: 10,00 EUR (monatlich)
Die Nutzung des Gemeindebusses ist kostenfrei und bedarf nur einer schriftlichen Anmeldung über die Kita.
Für Geschwister, die gleichzeitig in der Einrichtung betreut werden, reduziert sich der Beitrag für das 2. Kind einer Familie um 15,00 EUR.
Für Gastkinder
Betriebskostendefizitpauschale: 150,00 EUR (monatlich)